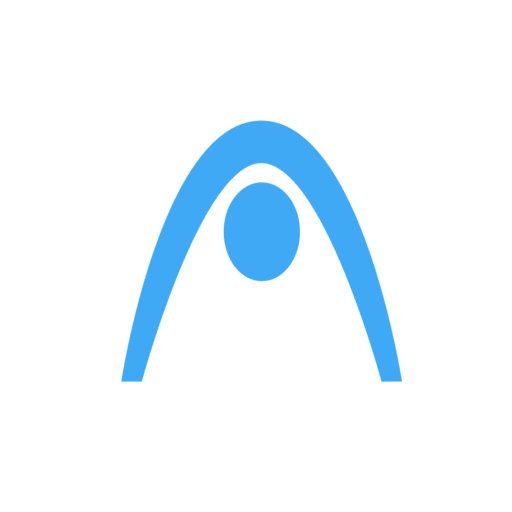Riss der Achillessehne: Was nun?

Sie sind ausgerutscht, umgeknickt, gestürzt und Ihnen ist dabei die Achillessehne gerissen? Gerne informieren wir Sie was nun auf Sie zukommt!
Was ist die Achillessehne?
Die Achillessehne befindet sich am Unterschenkel und ist die stärkste Sehne des Körpers. Sie bildet sich durch die Ansätze der Muskulatur des Unterschenkels (Musculi gastrognemii und Musculus soleus) aus und setzt am Fersenbeinknochen (Calcaneus) an. Sie überträgt dabei die Kraft der Muskulatur in die Beugung des Sprunggelenkes auf den Knochen. Ihre Länge beträgt zwischen 10-12 cm und ihr Durchmesser etwa 0,5-1 cm.
Wie viele Menschen sind betroffen?
Die Achillessehnenruptur ist die am häufigsten vorkommende Sehnenruptur des menschlichen Körpers [1].
In der Schweiz sind circa 25-47 Menschen pro 100.000 Einwohner betroffen, die Tendenz ist steigend. Die meisten Risse treten zwischen dem 37-44 Lebensjahr auf, mit einem Gipfel bei 40 Jahren. [2].
Wer ist betroffen?
Zu 86% sind Männer betroffen. Häufige passieren die Unfälle bei Ballsportarten wie Faustball, Badminton, Tennis und Squash [3]. Aber auch im Alltag kann die Sehne reissen.
Warum ist sie gerissen?
Vermutlich ist Ihre Sehne gerissen, da unerwartete und/oder ungewohnt hohe Belastungen auf sie eingewirkt haben. Dieser Belastung konnte Ihre Sehne nicht mehr nachgeben, sodass sie reisst. Dies kann bei einer gesunden Sehne passieren, aber auch bei einer Sehne, die vorher schon Schmerzen gemacht hat oder unter Entzündungen gelitten hat. Auch Medikamente können eventuell einen Einfluss haben z.B Anabole Steroide, oder Cortison.
Welche Symptome zeigen sich?
Viele Betroffene berichten über einen hörbaren, peitschenartigen Knall und stechende Schmerzen oberhalb der Ferse. Der Fuss kann nicht mehr aktiv gebeugt werden und es ist nicht mehr möglich auf dem Bein zu stehen. Meistens ist oberhalb des Fersenknochens eine Delle er tastbar. Zudem können sich auch Blutergüsse und Schwellung zeigen.

Welche Diagnostik findet statt?
Die Diagnose einer Achillessehnenruptur kann durch verschiedene klinische Tests gestellt werden. Ein häufig verwendetes Verfahren ist der Thompson-Test. Hierbei wird der Patient in Bauchlage positioniert und der Arzt oder Therapeut drückt sanft auf die Wadenmuskulatur des betroffenen Beins. Normalerweise führt dies zu einer Plantarflexion (Senkung des Fußes), wenn die Achillessehne intakt ist. Wenn jedoch keine Bewegung des Fußes beobachtet wird, deutet dies auf eine Ruptur der Achillessehne hin. Des Weiteren wird der Unfallhergang erfragt und in der Regel eine seitliche Röntgenaufnahme durchgeführt, um mögliche Begleitverletzungen, wie ein Abriss des Fersenknochens, auszuschliessen.
Darüber hinaus können bildgebende Verfahren wie Ultraschall oder Magnetresonanztomographie (MRT) eingesetzt werden, um die Diagnose zu bestätigen und den Grad der Verletzung zu beurteilen.
Aufgrund der Ergebnisse aus der Diagnostik, sowie des Alters und des sportlichen Anspruchs wird dann entschieden, ob eine konservative oder eine operative Therapie durchgeführt wird.
Welche Therapien gibt es?
Es kann sowohl eine operative als auch eine konservative Therapie stattfinden.
Mehrere grossangelegte Studien haben ergeben, dass die Operative keine Überlegenheit gegenüber der Konservativen darstellt. [5], [6], [7]
Beide Therapieformen haben unterschiedliche Vorteile:
Komplikationen |
Operative Therapie |
Konservative Therapie |
Rate erneuter Risse |
Ca. 4 % |
Ca.10% |
Wundheilungsstörungen |
Bis zu 30%, davon 5-10% schwerwiegend |
keine |
Schmerzen |
mehr |
weniger
|
Während eine Operation zu weniger Rerupturen führt, zeigt sich aber noch nicht, dass sie zu besseren funktionellen Ergebnisse in der Rehabilitation führt [8]
Operative Therapie
Bei der operativen Behandlung einer Achillessehnenruptur gibt es verschiedene Verfahren, die je nach Schwere der Verletzung und den individuellen Umständen des Patienten angewendet werden können.
Hier sind einige gängige operative Verfahren:
Offene Reparatur: Bei diesem Verfahren wird ein Schnitt entlang der Rückseite des Unterschenkels und der Achillessehne gemacht. Die gerissenen Enden der Sehne werden dann zusammengefügt und mit Nähten oder anderen Befestigungsmitteln fixiert.
Perkutane (minimal-invasive) Reparatur: Bei dieser Technik werden kleine Schnitte gemacht, durch die spezielle Instrumente eingeführt werden, um die gerissenen Enden der Sehne zu nähen oder zu verbinden. Dieses Verfahren hat oft den Vorteil einer schnelleren Genesung und weniger postoperativer Schmerzen im Vergleich zur offenen Reparatur.
Sehnentransplantation: In einigen Fällen, insbesondere bei großen Sehnenlücken oder schlechter Sehnenqualität, kann eine Sehnentransplantation erforderlich sein. Dabei wird eine Sehne aus einem anderen Bereich des Körpers, wie zum Beispiel dem großen Zeh, entnommen und in die Achillessehne eingepflanzt, um die Lücke zu schließen.
Verstärkung mit Sehnennähten oder Sehnentransplantaten: Manchmal wird die Achillessehne auch durch zusätzliche Materialien verstärkt, um die Stabilität zu verbessern und die Heilung zu fördern. Dies können Sehnennähte, Sehnentransplantate oder synthetische Implantate sein.
Die Wahl des optimalen operativen Verfahrens hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich des Ausmaßes der Verletzung, des Gesundheitszustands des Patienten, der Aktivitätsniveau und der Vorlieben des Patienten sowie der Erfahrung und Präferenzen des Chirurgen. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile jeder Option mit Ihrem Arzt zu besprechen, um die bestmögliche Behandlung für Ihre individuelle Situation zu finden.
Danach schliesst sich eine 6-8-wöchige Therapie mit einem festen, orthopädischen Schuh oder einer entsprechenden Orthese an. Dieser ermöglicht die Fixierung des Fusses in einer Spitzfussposition damit die Sehnennaht heilen kann.
Konservative Therapie
Bei der konservativen Therapie wird ebenfalls ein orthopädischer Schuh für 6-10 Wochen angelegt. Dieser gewährleistet die Annäherung der Sehnenenden, damit diese bestmöglich aneinanderwachsen können. Dazu gibt es je nach Modell unterschiedlich hohe Keile für die Ferse, die sich mit fortschreitendem Wundheilungsprozess immer mehr verkleinern.
Ob es ärztlich nun operativ oder konservativ behandelt wurden, die Physiotherapie ist in beiden Fällen angeraten. Auch die Studienlage zeigt, dass eine frühe funktionelle Mobilisierung zu guten Ergebnissen führt und keine Gefahr für einen erneuten Riss darstellt, sondern sogar bessere Ergebnisse im Bezug auf die Kraft der Wadenmuskulatur zeigt. [9], [10]
Physiotherapeutische Therapie
In der Physiotherapie werden zu Beginn eine eingehende Untersuchung und Befragung durchgeführt. Dabei ist besonders wichtig zu erfahren, welche Aktivitäten, Hobbys oder Sport der Betroffene gerne wieder machen würde. Oder ob es primär um die Rückführung in den Alltag oder um die Ausführung des Berufes geht. Ist dieses Ziel definiert, kann es mittels eines funktionellen Tests dem Return to Activity Algorithmus (RTAA) [11] quantifiziert und festgehalten werden. Anhand der Einordnung in eines der Level orientiert sich dann der Rehabilitationsplan.
Zusätzlich zur Zielformulierung werden die Wundheilungsphasen des Bindegewebes beachtet welche eingehend in folgendem Blogbeitrag beschrieben sind [12].
Während der ersten 6 Wochen findet bereits Physiotherapie statt. In dieser Zeit gilt es wieder Mobilität und Kontrolle zurück zu gewinnen. Einige Studien zeigen auf, das eine frühe Gewichtsbelastung direkt nach OP oder 2 Wochen danach mit Orthese sicher ist und Vorteile aufweist bezüglich der Zufriedenheit der Rehabilitation und der Kraft der Wadenmuskulatur nach 12 Monaten. [13], [14]Die wieder gewonnene Kontrolle dient dem Ziel Funktionen des Alltags wie Gehen, Knien und Treppen steigen zu verbessern. Zudem wird mit zusätzlichen Massnahmen wie Kompression und Kühlung der Heilungsprozess unterstützt. Auch eine Lymphdrainage oder ein Stützstrumpf können bei starken Schwellungen zum Einsatz kommen.
Nach 6-12 Wochen kann mit dem Gehen ohne Orthese begonnen werden. Hier gilt es nun den Ablauf des Ganges wieder voll herzustellen und falls nötig die einzelnen Gangphasen (z.B. Standbeinphase, Abdruckphase, usw.) intensiv zu üben. Auch das Gehen auf unebenem Untergrund und Auf- oder Abwärts wird wieder erlernt. Die Muskulatur wird weiter gekräftigt, sodass Aktivitäten wie z.B. auf den Zehen stehen und gehen wieder möglich werden.
Nach 6 Wochen kann die Dorsals Extension über 0 ° gefördert werden. Die volle Beweglichkeit sollte nach 12 Wochen angestrebt werden.
Sobald die Alltagsfunktionen wiederhergestellt sind, können dann auch schwere motorische Anforderungen wie z.B. das Hüpfen auf beiden und einem Bein geübt werden.
Die Entscheidung wann z.B. wieder gejoggt oder die gewünschte Sportart ausgeführt werden darf, orientiert sich neben den Vorgaben des Operateurs und der Einhaltung der Wundheilungsphasen an den funktionellen Fähigkeiten, die wie oben beschrieben mittels z.B RTAA quantitativ ermittelt werden können. Einen grossen Einfluss haben wohl auch physiologische Faktoren (Vermeidungs- Verhalten aus Angst), auf die Rückkehr zum Sport, diese können mit Fragebögen ermittelt werden. [15]
In der Regel kann man aber je nach Sportart nach 3 -12 Monaten wieder in den Sport zurückkehren. Es kann zum Beispiel nach ca. 4-6 Monaten und den entsprechenden Voraussetzungen wieder mit leichtem Joggen bei 6-9 km/ h begonnen werden. Der Einstiegt in Sportarten mit vielen Start und Stopphasen empfiehlt sich nach ca. 7- 8 Monaten und Kontaktsportarten nach 9-12 Monaten.
Sollten Sie also unter einer Ruptur leiden können Sie uns gerne kontaktieren. Wir bei Actiway Physio helfen Ihnen auf eine aktive, selbstwirksame und beratende Weise, wieder in den Alltag oder den Sport zurückzukommen.
Quellen:
[1] – https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00113-014-2627-y
[2] -http://www.physio.insel.ch/fileadmin/physiotherapie/physiotherapieusers-/Pdf/Der_Achillessehnen-Riss-Patienteninformation
[3] – https://www.germanjournalsportsmedicine.com/fileadmin/content/archiv2000-/heft05/a01_0500.pdf
[5] – https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1071100717728687;
[6] https://online.boneandjoint.org.uk/doi/full/10.1302/0301-620X.93B8.25998
[7] https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0363546512453293
[8] – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22159659/
[9] – https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0363546507307503
[10] – https://www.sana.de/media/Kliniken/rummelsberg/1-medizin-pflege/fuss-sprunggelenkchirurgie/merkblaetter_richter/leitlinie.pdf;
[11] – https://www.osinstitut.de/rtaa-untere-extremitaet
[12] – https://www.physiotherapiesanktgallen.ch/2018/12/was-tun-nach-einer-umknickverletzung-am-sprunggelenk-physiotherapie-actiway-klart-euch-auf/
[13] – https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0363546507307503;
[14] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1619998719301254
[15] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9926006/